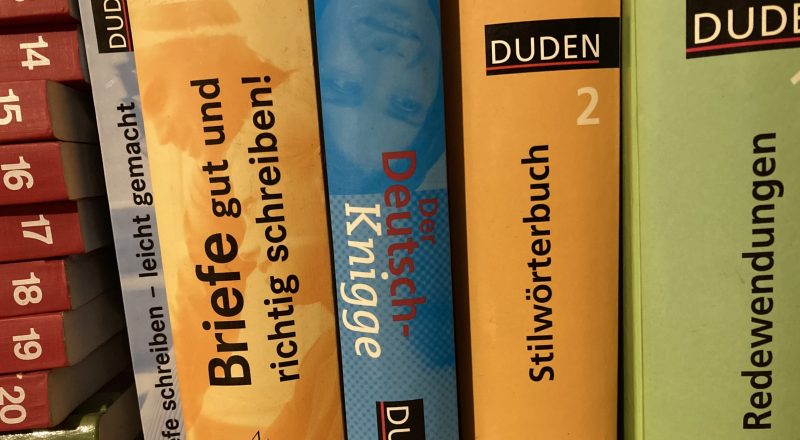Gendern oder nicht? Müssen sich Frauen mitgemeint fühlen, wenn mit dem generischen Maskulinum nur Männer angesprochen sind? Die Debatte ist hoch politisch – weil sie an den gesellschaftlichen Verhältnissen rüttelt.
- Das generische Maskulinum – die männliche Form als Bezeichnung für alle Menschen – wird zunehmend missverständlich.
- Gendern ist nicht nur eine Frage der Sprache und des Stils.
- Wer gendergerecht spricht und schreibt, stößt auf gesellschaftspolitische Themen.
Kürzlich war der „Standardrentner“ Thema im Wirtschaftsteil der Frankfurter Rundschau. Er erhalte im Westen 1512 Euro im Monat, berichtete die Redaktion. Einige Kolleginnen und Kollegen fragten sofort: „Und wie viel bekommen Frauen im Ruhestand?“ Sie waren zunächst gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Bezeichnung „Standardrentner“ Frauen mitmeinen könnte.
Was zeigt: Das generische Maskulinum – die männliche Form als Bezeichnung für alle Menschen – wird zunehmend missverständlich in dem Maße, wie eine gendergerechte Sprache üblich wird. Wer seit Jahren von Rentnerinnen und Rentnern spricht, hört bei „Rentner“ Frauen nicht mehr mit. Gendern ist damit auch eine Frage der Eindeutigkeit.
Weibliche Sprachformen helfen, die Lebenssituation von Frauen und Männern differenziert zu betrachten
Und was ist nun mit den Frauen? Die bekommen nach dem Konzept „Standard- oder Eckrentner“ gleich viel. Falls sie die Bedingungen erfüllen: vor der Rente 45 Jahre lang arbeiten und das Durchschnittseinkommen verdienen. Was Frauen, oft wegen der Kinder, seltener schaffen als Männer.
Sie merken: Wer gendergerecht spricht und schreibt, stößt auf gesellschaftspolitische Themen. Vertiefen wir das. Schauen wir auf die tatsächlich überwiesene Altersrente und verwenden weibliche und männliche Sprachformen: „Im Jahr 2018 als jüngstem verfügbaren Stand haben Rentnerinnen und Rentner im Westen durchschnittlich monatlich 864 Euro erhalten.“ Alles in Ordnung so? Ja, aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze lautet: „2018 haben im Westen Rentner durchschnittlich 1130 Euro erhalten und Rentnerinnen 647 Euro.“
Dieses Beispiel zeigt: Es reicht nicht, einfach weibliche Sprachformen zu ergänzen. Wenn Journalistinnen und Journalisten die bestehenden Verhältnisse richtig beschreiben wollen, müssen sie regelmäßig prüfen, ob Durchschnitts- und Summenangaben tatsächlich aussagekräftig sind – oder ob nicht die Lebenssituationen von Frauen und Männern so unterschiedlich sind, dass sie differenziert betrachtet werden müssen.
Das Gendern hilft dabei. Wer nicht mehr nur von zehn Amtsleitern einer Verwaltung sprechen will, sondern von zehn Amtsleiterinnen und Amtsleitern, ist schnell bei zwei Amtsleiterinnen und acht Amtsleitern. Und das ist eine wichtige neue Information für Leserinnen und Leser.
https://twitter.com/hessenschau/status/1386301771585228806?s=20
Gendern – das geht nicht mit allen Begriffen
In den vergangenen Wochen achtete die FR-Redaktion noch sensibler als sonst auf die angemessene Beschreibung von Menschengruppen. Medien berichteten etwa, vor allem Frauen trügen die Proteste in Belarus. Das deckte sich mit den Bildern, auf denen nur wenige Männer zu sehen waren. Dennoch berichteten Nachrichtenagenturen durchgehend von „Demonstranten“.
Es gibt Begriffe, die sich kaum gendern lassen. Putzfrau ist geläufig, Putzmann weniger. Wir kennen Krankenschwestern und eine First Lady – aber keine Krankenbrüder und keinen First Gentleman. Und es gibt Staatsmänner, aber keine Staatsfrauen.
So spiegelt eine patriarchalisch geprägte Sprache die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Organisation der Gesellschaft wider. Und umgekehrt schärft das Streben nach geschlechtsneutraler Sprache den Blick auf die Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern.
Sprache ist Haltung. Inklusives Reden und Schreiben sind eine Frage der Gerechtigkeit – dieser Meinung ist FR-Chefredakteur Thomas Kaspar. Kathrin Gunkel-Razum, Leiterin der Duden-Redaktion, erläutert im Interview, warum richtig Gendern wichtig ist.